Die Angst vor der Atombombe und dem nuklearen Krieg fand im Hollywood-Kino der
50er Jahre durch eine aufkommende Welle von Sciene-Fiction-Filmen Ausdruck.
Fliegende Untertassen und Außerirdische wurden zum Symbol der Angst vor dem Unbekannten.
Einen Schritt weiter ging
Der Tag, an dem die Erde stillstand von 1951.
Im humanistischen Film von Robert Wise sind die Außerirdischen den Menschen nicht feindlich gesinnt,
sondern um die selbstzerstörerischen Tendenzen auf der Erde besorgt. Ihr Ziel ist deshalb die
Erhaltung des Friedens auf dem blauen Planeten.
Die nicht weniger unzulänglichen Besucher haben sich eine Kontrollinstanz von Robotern
geschaffen, die quasi als intergalaktische Polizei für Frieden sorgt und dabei sogar
notfalls bereit ist, Gewalt gegen möglicherweise auftretende Aggressoren anzuwenden.
Der Gesandte Klaatu stellt der Erdbevölkerung ein Ultimatum. Er droht ihr mit Zerstörung,
falls sie nicht willens ist, in Frieden zu leben. Als eindrucksvolle Demonstration der
Macht der Roboter lässt er für eine Stunde alle nicht lebensnotwendigen Maschinen der Welt
stillstehen, woraus sich der Titel des Filmes ableitet.
Zusammen mit The Thing from another World (Musik: Dimitri Tiomkin) gehört
The Day the Earth stood still zu den frühen Science-Fiction-Filmen der 50er Jahre,
in denen fliegende Untertassen die Erde besuchen. Der gut gemeinte Film von Robert Wise
wirkt heute natürlich schon etwas naiv und kurios. Gerade die "Law & Order"-Politik der
selbstgeschaffenen Roboter als Eingeständnis der eigenen Unfähigkeit zum friedlichen
Zusammenleben, macht aus der finalen Botschaft einen etwas befremdlichen Schrei nach
Kontrolle von außen. Dennoch besitzt die spannende und geradlinige Inszenierung auch heute
noch einigen Unterhaltungswert. Dies liegt nicht zuletzt auch daran, dass sie auf den
übermäßigen Einsatz von Trickeffekten, der heute allein antiquiert anmuten würde, verzichtet.
Besonders interessant wird die Geschichte natürlich auch unter Berücksichtigung des
politisch-gesellschaftlichen Hintergrundes der Entstehung.
Regisseur Robert Wise hatte Bernard Herrmann als Cutter bereits bei den frühen Filmen von Orson
Welles wie Citizen Kane (1941) und The Magnificent Ambersons (1942) kennen-
und schätzen gelernt. Für The Day the Earth stood still wollte er zunächst auf
jegliche Musik verzichten, um sich nicht den Vorwurf der Manipulation einzufangen.
Schließlich engagierte er dann doch Herrmann, dem er bei der Vertonung sogar alle Freiheiten
gab. Wise wurde nicht enttäuscht. Er bekam eine der experimentellsten und ungewöhnlichsten,
aber trotzdem hervorragend zu den Bildern passenden Arbeiten des Komponisten geliefert. Herrmann benutzte
eine kleine, ungewöhnlich zusammengestellte Besetzung von nur knapp 30 Spielern, darunter
zwei Theremine und elektronisch verstärkte Streichinstrumente. Die Theremine, die Miklós Rózsa
bereits 1945 bei seinen Film-Noir-Partituren zu The lost Weekend und Spellbound
eingesetzt hatte und die auch Dimitri Tiomkin bei The Thing from another World
aus dem selben Jahr verwendete, geben der Musik ihre bizarr-fremdartige Atmosphäre.
Auch wenn Herrmann in der Prelude eine Art Hauptthema präsentiert, liegt der Schwerpunkt
seiner Musik stärker auf den vielfältig erzeugten Klangwirkungen und -effekten als einer
thematischen Verflechtung. Sehr subtil und völlig unsentimental arbeitete er mit kleinen,
meist einfachen musikalischen Parzellen, denen er durch den geschickten Einsatz verschiedener
Instrumentgruppen ein erstaunliches Maß an klanglichen Schattierungen und Akzenten entlockte.
Ganz selten nur gibt es in Stücken wie "Lincoln Memorial" mit dem Spiel der Trompete
dezentes Pathos zu hören.
Das nicht zuletzt dank der Theremine unkonventionelle Vertonungskonzept hat kaum etwas mit
der traditionellen Kinosinfonik des Golden Age gemeinsam, läuft sogar der Erwartungshaltung
des Zuschauers/Hörers entgegen, woraus sich ein faszinierender Verfremdungseffekt entwickelt,
der dem Unbekannt-Mysteriösen der Außerirdischen eine musikalische Ebene verleiht.
Natürlich braucht eine derart moderne Partitur einige Hördurchgänge und kann kaum als leicht
zugänglich bezeichnet werden. Deshalb ist die CD für Herrmann-Einsteiger ihres Ranges zum Trotz
weniger zu empfehlen.
Die Einspielung von Joel McNeely mit einer glänzenden Celia Sheen am Theremin erweist sich
der herausragenden Herrmann-Musik vollauf gewachsen, und setzt die Stereoeffekte geschickt
in Szene (ein Hören per Kopfhörer lohnt sich unbedingt). Die bestechend klingende Aufnahme
und das informative Booklet runden den exzellenten Gesamteindruck der Edition ab. (mr)


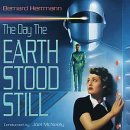 "Besuch aus einer anderen Welt"
"Besuch aus einer anderen Welt"