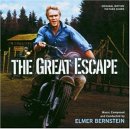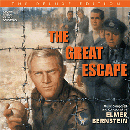|
 |
INHALT
|
Rezension
Mit Gesprengte Ketten schuf John Sturges (Die glorreichen Sieben)
1963 einen Klassiker des Kriegabenteuerfilms. Basierend auf wahren Begebenheiten wird
darin die Geschichte einer von alliierten Offizieren initiierten Massenflucht aus einem
deutschen Gefangenenlager während des zweiten Weltkriegs erzählt. Sturges besetzte
The Great Escape, so der Originaltitel, mit zahlreichen Stars, darunter Steve McQueen,
Richard Attenborough, James Garner, Charles Bronson sowie James Coburn. Er setzte ganz auf
den Unterhaltungswert der spannenden Handlung. Mit vollem Erfolg, denn der fast dreistündige
Film wurde zum großen Kassenschlager und Publikumsliebling. Doch über das reine Starkino
hinaus schafft es Gesprengte Ketten nicht. Dafür spiegelt der Film die realen
Ereignisse zu oberflächlich, interessiert sich zu wenig für die psychologische Dimension
der Geschichte. Wenn der "Ausbrecher-König" Hilts (Steve McQueen) mehrfach wochenlange
Einzelhaft ohne Folgen übersteht oder der Sinn des verlustreichen Unterfangens praktisch zu
keinem Zeitpunkt hinterfragt wird, offenbaren sich die inhaltlichen Grenzen der Produktion.
Auch viele Details des Lagerlebens und der Fluchtvorbereitung wirken unglaubwürdig. Woher zum
Beispiel die zahlreichen für den Ausbruch benötigten Werkzeuge und Utensilien
stammen, wird bestenfalls nur angedeutet. Ebenso enttäuscht, wie wenig der Film auf das
politische Klima der Zeit eingeht. Symptomatisch für den reinen Unterhaltungscharakter steht
die Tatsache, dass sich McQueen als Motorradliebhaber eine spektakuläre
Verfolgungsjagd ins Drehbuch schreiben ließ.
Elmer Bernstein hatte mit Sturges zum ersten Mal beim Westernklassiker Die Glorreichen Sieben (1960) zusammengearbeitet. Es folgten drei weitere gemeinsame Projekte: The Great Escape (1963), The Hallelujah Trail (1965) sowie McQ (1974). The Great Escape gehört vor allem wegen seinem markanten, patriotischen Marschthema zu den populärsten Arbeiten im Werk des 2004 verstorbenen Komponisten. Das Hauptthema ist mittlerweile fest in der Popkultur verankert, wurde unlängst in Chicken Run (2000) gekonnt von John Powell und Harry Gregson-Williams parodiert. Der Marsch bleibt über die vollen neunzig Minuten Laufzeit zentraler melodischer Gedanke der Komposition und taucht immer wieder in den zahlreichen Actionsequenzen motivisch auf. Dazu treten verschiedene Spannungsmotive, die die Bedrohung durch die Lageraufseher spiegeln, und melancholische Streicherstücke, die Freundschaft und Zusammenhalt zwischen den Männern unterstreichen. Bernstein bedient sich einer schlanken Orchestrierung, in der Schlagwerk und Blech naturgemäß eine gewichtige Rolle spielen, aber Streicher, Flöten und Harfe die lyrischen Zwischentöne setzen. Trotz moderner Einflüsse in Stil von Aaron Copland bedient sich Bernstein einer einfachen, aber äußerst effektvollen Orchestersprache. Obwohl gelegentliche Redundanzen vorkommen, überrascht die abwechslungsreiche Gestaltung. Hier stehen Marsch, atmosphärisch-dichte Suspense-Stücke, dezentes Mickey Mousing und schöne Streichermelodik wirkungsvoll nebeneinander. Insgesamt erreicht die Bernstein-Musik allerdings nicht ganz die Qualität der besten Arbeiten des Komponisten wie Die Glorreichen Sieben, Die Zehn Gebote (1956) oder Wer die Nachtigall stört (1962). Dennoch handelt es sich um eine packende, spannungsgeladene Vertonung, die auch heute noch zu begeistern vermag. Die Musik auf CD:
LP-Schnitt:
Varèse Sarabande VSD-6582 Dirigent: Elmer Bernstein 32:17 Min.
Tracklist:
Deluxe Edition: Tracklist:
CD 1:
Deutscher Titel: "Gesprengte Ketten" Regie: John Sturges Darsteller: Steve McQueen, Richard Attenborough
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||