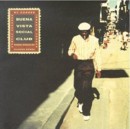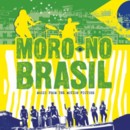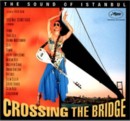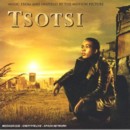Es ist einer der vielen Widersprüche unserer westlichen
Gesellschaft, dass trotz immer weiter eskalierender Konflikte mit anderen
Kulturkreisen, sich offenbar zugleich eine große Faszination und Begeisterung für deren Folklore
entwickelt. Beispielsweise gehören Indische Bollywood-Musicals inzwischen zu den
Quotenhits im Fernsehen (zumindest auf RTL 2) und scheinen sich die zugehörigen DVDs sowie Filmmusik-CDs
bestens zu verkaufen. Orientalische und afrikanische Rhythmen bilden ein immer beliebter
werdendes Stilmittel in der gegenwärtigen Popmusik. Der Trend, Filme mit Weltmusik zu begleiten,
ist auch in Nicht-Bollywood-Produktionen allgegenwärtig. Man denke nur an
die ethnisch geprägten Vertonungen eines Mychael Danna oder die Orientalismen
in Hollywood-Produktionen Hans Zimmers wie z.B. dem
Gladiator
oder
Black Hawk Down. Andere Länder und deren Folklore
mittels Dokumentationen zu entdecken, gehört zu den weiteren Begleiterscheinungen
dieses Trends.
Buena Vista Social Club (1999):
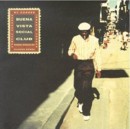 |
|
CD-Cover |
|
|
Der größte Erfolg in dieser Hinsicht war vor ein paar Jahren die für den
Oscar nominierte Dokumentation
Buena Vista Social Club (1999), in der
Wim Wenders und Ry Cooder in Kuba den begnadeten Musikern des gleichnamigen
Clubs begegnen, ihre Lebensgeschichte und ihre Musik vorstellen und so
zu einer späten Renaissance und Weltruhm verhelfen. Der Clou: Die Musiker
waren zum Zeitpunkt der Dreharbeiten weit über 70 bzw. 80 Jahre alt. Den trotz trivialer Texte mitreißenden
und nur so vor Lebensfreude strotzenden Son (eine Mischung aus afro-kubanischen
Trommelrhythmen und spanischer Gitarrenmusik) hört man dieses Alter aber nicht
an. Mittlerweile ist die kubanische Musik sogar bekannter als die ursprüngliche
Wenders-Doku, hat mit erfolgreichen Soloalben beteiligter Musiker wie Ibrahim
Ferrer (1927-2005) oder Compay Segundo (1907-2003) den filmischen Kontext längst
hinter sich gelassen.
Moro No Brasil (2002):
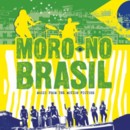 |
|
CD-Cover |
|
|
Von diesem Erfolg kann Mikas Kaurismäkis Dokumentation
Moro No Brasil (2002)
nur träumen. Wie der Name bereits andeutet, geht es hier um die Brasilianische
Musikszene, die viel mehr zu bieten hat als nur Bossa Nova und Samba. Der Finne
hat sich auf eine 4000 Kilometer lange Reise quer durch Brasilien gemacht,
um den unterschiedlichen Musikstilen und -einflüssen sowie ihren Wurzeln nachzuspüren. Die Reise
beginnt im Nordosten des Landes bei den Ureinwohnern und ihrer Folklore. Mit
dem Besuch verschiedener Regionen lernt der Hörer vielseitige Musikstile wie
Frevo (schnelle Tanzmusik, die zum Karneval im Bundesstaat Pernambuco gespielt wird),
Maracatú (ein Vorläufer des Samba), Coco und Forró (beides Rhythmus- und Tanzstile
aus dem Nordosten) sowie Embolada (Lieder aus dem Küstengebiet im Nordosten)
kennen. Die vielseitige Entdeckungsreise kulminiert schließlich in einem Live-Mitschnitt eines Konzertes in
"Mika’s Bar" (in Anspielung auf eine Lieblingskneipe
des Regisseurs in Rio de Janeiro).
Crossing the Bridge - The Sound of Istanbul (2005):
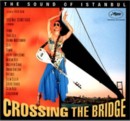 |
|
CD-Cover |
|
|
Einen musikalischen Schmelztiegel zwischen Orient und Okzident erlebt in
diesen Jahren auch die größte Stadt am Bosporus - Istanbul. Hierhin
begibt sich der Schlagzeuger Alexander Hacke von den Einstürzenden Neubauten
in der Dokumentation
Crossing the Bridge - The Sound of Istanbul (2005).
Der Regisseur Fatih Akin kam zusammen mit Hacke im Zuge der Musikproduktion
zu dem preisgekrönten Drama
Gegen die Wand erstmalig mit der lebendigen
Istanbuler Musikszene in Berührung. Entstanden ist ein bemerkenswerter
Streifzug, der Musikstile von Pop, Chanson über Hiphop, Rap, Punk bis hin
zur typischen Folklore versammelt. Besonders sympathisch ist dabei,
dass Hacke sowohl berühmte Sänger- und Sängerinnen als auch einfache
Straßenmusiker vor der Kamera interviewt. Ein besonderer Höhepunkt der stilistisch
kunterbunten Zusammenstellung ist aber wohl der in einem alten Badehaus aufgenommene Klagegesang "Ehmedo"
der kurdischen Sängerin Aynur. Auch editorisch kann sich die Filmmusik sehen lassen:
Im Gegensatz zu den anderen hier vorgestellten
CDs verfügt
Crossing the Bridge über ein ausführliches Booklet, in dem
detailliert auf die verschiedenen Musikstile und beteiligten Künstler
eingegangen wird.
Tsotsi (2005):
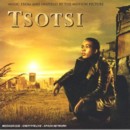 |
|
CD-Cover |
|
|
Keine Dokumentation, sondern die Geschichte einer Kindheit in
Johannesburg - das ist der Oscarprämierte Spielfilm
Tsotsi (2005).
Der Titel steht im Straßenslang für Gangster und Schläger. Und genau
in diese üble Szene gerät ein junger Südafrikaner nach dem Aids-Tod der
Mutter und der Flucht vor dem alkoholabhängigen Vater. Die Filmmusik
könnte aber auch einer Dokumentation entspringen. Sie besitzt kaum
filmdramaturgische Funktion, sondern bildet vor allem das Lebensgefühl
der Jugendlichen im Ghetto in Form von Rap- und Hiphop-Songs mit
Reggae-Einflüssen ab. Erst in der zweiten Hälfte der CD öffnet sich die
Musik stärker afrikanischen Rhythmen und Gospel (vermutlich als Parallele
zur Läuterung des Protagonisten), macht aber mit atmosphärischen Stücken
(geschrieben von den Südafrikanischen Komponisten Mark Kilian und Paul Hepker)
und leichtem Gitarrenpop auch manches Zugeständnis an den Europäischen
Musikgeschmack. Leider wird der Hörer mit der CD ziemlich alleingelassen,
denn es gibt weder erhellende Hintergrundinformationen noch einen Abdruck
der zum Teil politischen und sozialkritischen Texte. So kann man die Wut
und Verzweifelung hinter den aggressiv vorgetragenen Reimen nur erahnen.
Fazit:
Alle der hier erwähnten CDs bieten faszinierende Einblicke in die
lebendige Musikszene fremder Länder jenseits der Beliebigkeit des
Pop-Mainstreams und abgedroschener Weltmusik-Klischees. Dieser
Umstand macht den Zugang zu den Songs allerdings nicht immer leicht.
Tatsächlich setzen sie ein offenes Ohr für Neues und Anderes voraus.
Dennoch: die Entdeckungsreise lohnt sich, dürfte helfen manches einseitige
Zerrbild in der Medien ein klein wenig zu entschärfen. (mr)